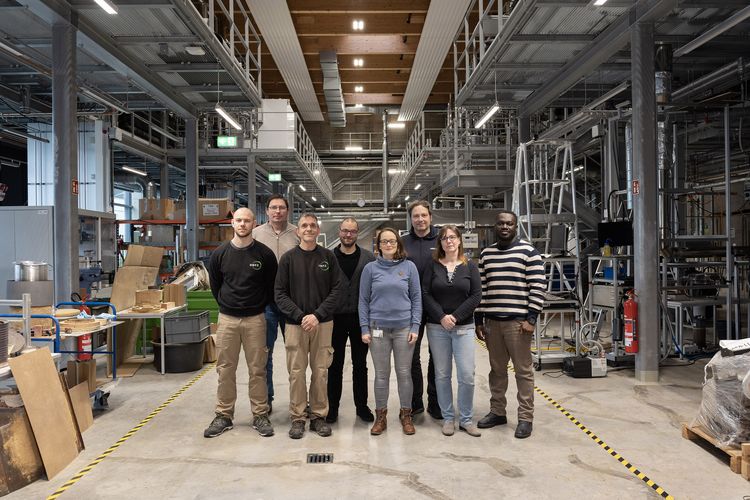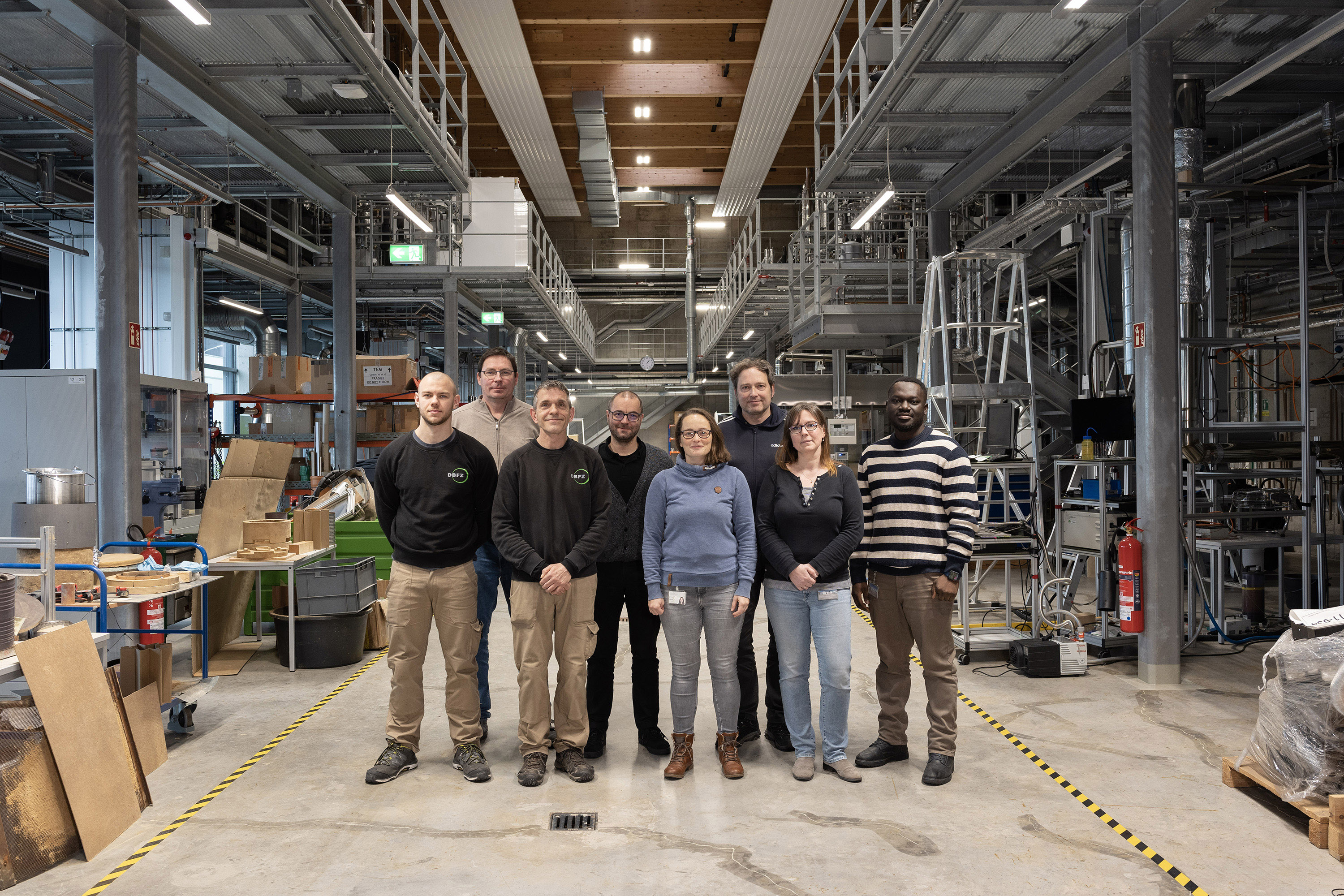Themen der Arbeitsgruppe
Die Arbeitsgruppe Kleinanlagentechnik hat das Ziel thermo-chemische Konversionsanlagen sowie notwendige sekundären Abgasreinigungssysteme zu entwickeln und zu optimieren. Ziel ist, das Emissionsniveau der Anlagen soweit zu senken, dass die gesundheits- und umweltrelevanten Immissionsvorgaben der WHO lokal als auch global eingehalten werden können. Weiteres Ziel ist zudem die verfügbaren Biomasseressourcen möglichst nachhaltig einzusetzen. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft werden entsprechend Prozesse und Methoden entwickelt, welche stoffliche und energetische Biomassenutzung kombinieren. Ein besonderer Fokus ist hierbei die Erzeugung von anorganischen Wertelementen aus Rückständen der thermo-chemischen Konversion wie beispielsweise Biosilika aus siliziumreichen Biomassen.
Fokusthemen der Arbeitsgruppe:
- Entwicklung und Optimierung von flexibel betreibbaren und emissionsarmen manuell beschickten und automatischen Biomasse-Festbrennstofffeuerungen im Leistungsbereich bis 400 kW (Einzelraumfeuerungen und Kessel)
- Entwicklung und Optimierung von katalytischen Emissionsminderungsverfahren
- Optimierung, Charakterisierung und Integration von weiteren Emissionsminderungsmaßnahmen in Anlagen der thermochemischen Konversion von Biomasse (Regelungssysteme, Abscheider)
- Charakterisierung von Kleinfeuerungsanlagen (nach Norm ERF, Kessel sowie Kocher)
- Charakterisierung von Katalysatoren und porösen Materialien
- Entwicklung von Prozessen und Methoden zur Extraktion und Nutzung von Wertelementen aus Konversionsrückständen der thermo-chemischen Umwandlung
- Recycling von Katalysator- und Filtermaterialien
Prof. Dr. rer. nat. Ingo Hartmann ist Leiter des Forschungsschwerpunktes Katalytische Emissionsminderung am DBFZ. Seit 08/2008 ist er am DBFZ im Bereich Thermo-chemische Konversion tätig. 1998 bis 2002 studierte er an der HTWK Leipzig mit dem Abschluss Diplom-Ingenieur (FH) Energietechnik-Umwelttechnik. 2003 bis 2007 promovierte er im Fachgebiet Chemie an der Universität Leipzig. Von 2002 bis 2003 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH und 2006 bis 2008 an der HTWK Leipzig. Im November 2020 begann er als Honorarprofessor zur Luftreinhaltungstechnik an der HTWK Leipzig zu arbeiten. Seit Oktober 2023 hat er die Vertretungsprofessur für Umwelttechnik an der HTWK Leipzig inne.
Dr. Mirjam Müller studierte Energie- und Umwelttechnik an der HTWK Leipzig. Seit 2010 beschäftigt sie sich mit verschiedenen Aspekten der Emissionsminderung und der Prozesstechnik im Bereich Biomasseverbrennung. Ein besonderer Bearbeitungsschwerpunkt war die Anwendung und Integration von Katalysatoren im Rahmen ihrer 2020 abgeschlossenen kooperativen Promotion an der Fakultät für Chemie und Mineralogie der Universität Leipzig zusammen mit der HTWK Leipzig Fakultät Maschinenbau und Energietechnik sowie dem DBFZ. Seitdem ist sie als Post-Doc am DBFZ tätig und leitet kommissarisch die Arbeitsgruppe Kleinanlagentechnik seit Dezember 2023. Aktuell arbeitet sie in einem Projekt an der Entwicklung von Pyrolysekochern für Äthiopien. Weiterhin bearbeitet sie verschiedene Projekte zur Charakterisierung und Minderung von Partikelemissionen aus Kleinfeuerungsanlagen.
Dr. Bettina Stolze studierte Chemie und promovierte auf dem Gebiet der heterogenen Katalyse an der Universität Leipzig. Seit 2015 ist sie Mitglied der Arbeitsgruppe Kleinanlagentechnik, wobei ihr Forschungsschwerpunkt in der katalytischen Abgasnachbehandlung zur Schadstoffreduzierung nach thermo-chemischer Konversion biogener Brennstoffe liegt. Unter Berücksichtigung der SDG (Sustainable Development Goals) werden neue Katalysatoren synthetisiert, charakterisiert und katalytisch sowohl im Modellgas als auch realen Abgas getestet. Ein nachhaltiger Ansatz für diese Katalysatoren ist die Nutzung von biogenem Silica als Katalysatorträger, welches aus biogenen Rest- und Abfallstoffen durch thermo-chemische Konversion gewonnen wird.
René Bindig studierte "Chemie" an der Universität Leipzig. In seiner Masterarbeit beschäftigte er sich mit der mikrowellenunterstützten katalytischen Nachverbrennung an Kleinfeuerungsanlagen. Seit 2011 ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Thermo-chemische Konversion, Arbeitsgruppe "Kleinanlagentechnik" tätig. Er leitet mehrere Forschungsprojekte, in denen er sich u.a. mit der Entwicklung von emissionsarmen Kleinfeuerungsanlagen sowie entsprechender Emissionsminderungstechnologien beschäftigt. Aktuell promoviert er in Kooperation mit der Universität Halle zum Thema „Verfahren zur Entwicklung von Katalysatoren zur Abgasnachbehandlung an Kleinfeuerungsanlagen”.
Mario König beschäftigt sich mit Maßnahmen zur primären und sekundären Emissionsminderung an kleinen und mittelgroßen Feuerungsanlagen. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit am DBFZ ist die Erforschung sekundärer Maßnahmen zur Minderung von Staub, NOX, SO2, HCl und PCDD/PCDF an mit biogenen Reststoffen betriebenen Feuerungsanlagen im Leistungsbereich von 100 kW bis 5 MW thermischer Leistung. Dabei kommen Staubabscheider, SCR-Verfahren und Sorptionsverfahren sowie deren Kombination zum Einsatz. Er startete seine wissenschaftliche Tätigkeit am DBFZ Anfang 2011 nach dem Abschluss seines Diplomstudiums Umwelttechnik an der TU Dresden. Er pflegt eine Forschungskooperation mit der Universität Talca (Fakultät für Ingenieurwesen) in Chile und verbrachte dort bereits drei längere Forschungsaufenthalte. Aktuell promoviert er in Kooperation mit der Universität Halle zum Thema „Entwicklung und Anwendung neuartiger SCR-Katalysatoren für die Niedertemperatur-Denitrifikation von Abgasen aus der thermochemischen Umwandlung biogener Festbrennstoffe“.
Thomas Schliermann studierte Physik an der Universität Würzburg. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter beschäftigte er sich mit porösen Kohlenstoffen, elektrochemischen Energiespeichern und Nanomaterialien zur Wasserstoffspeicherung. Parallel arbeitete er am Bayerischen Zentrum für Angewandte Energieforschung (ZAE Bayern) in Würzburg zur Herstellung und Charakterisierung von Kohlenstoffnanofasern. Dort konnte er seine Kenntnisse in Charakterisierungsmethoden wie der Gassorption, Röntgenbeugung und Röntgenkleinwinkelstreuung sowie Ramanspektroskopie vertiefen. Seit 2015 arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am DBFZ zu Fragen der stofflich-energetischen Nutzung von landwirtschaftlichen Reststoffen wie Reisspelzen. Dabei steht die Materialsynthese, Eigenschaftsoptimierung und Charakterisierung von biogenem Siliciumdioxid auf Basis von Silicium-reichen Aschen im Vordergrund. Seinen Aufgabenbereich runden Entwicklungsprojekte zur Emissionsminderung und internationale Zusammenarbeiten ab.
Dr. Ing. Clement Owusu Prempeh ist Verfahrenstechniker und Postdoktorand. Er ist seit 2020 am DBFZ, wo er sich mit der chemischen Vorbehandlung von Biomasserückständen aus der Lebensmittelproduktion und deren Verbrennungseigenschaften für die Wärmenutzung beschäftigt. Seine Promotion schloss er 2024 an der Universität Rostock im Bereich Umwelttechnik ab. Zu seinen Beiträgen auf diesem Gebiet gehören Veröffentlichungen wie „Comparative Study of Commercial Silica and Sol-Gel-Derived Cornhusk Silica as Supports for Low-Temperature Catalytic Methane Combustion“, in der die Synthese und Charakterisierung von biogenem Siliciumdioxid als Träger für die katalytische Methanverbrennung bei niedrigen Temperaturen untersucht wird. Dr. Owusus aktuelles Projekt konzentriert sich auf transformative Forschung, die die Entwicklung von Pyrolyse-Kochöfen für die äthiopische Gemeinschaft umfasst und darauf abzielt, nährstoffreiche Biokohle zu erzeugen, um die Bodenfruchtbarkeit und die Ernährungssicherheit in Äthiopien zu verbessern.
Jan Kossack ist staatl. geprüfter Techniker für Prozessautomatisierung und Energietechnik. Seine Tätigkeitschwerpunkte liegen bei Prüfstands- und Feldmessungen sowie im Bereich von Konstruktionsaufgaben. Er ist dabei zuständig für die Erstellung von CAD-Zeichnungen.
Sebastian Völker ist ausgebilderter Mechatroniker. Er ist führt Prüfstands- und Feldmessungen wie auch Aufgaben bei der Messgerätewartung durch. Entsprechend seiner Ausbildung übernimmt er auch Tätigkeiten im Bereich Anlageninstallation und Automatisierung.
David Reitmajer ist seit April 2025 am DBFZ als Doktorand tätig. Er absolvierte sein Bachelorstudium in Verfahrens- und Umwelttechnik an der HTWG Konstanz und schloss 2024 darauffolgend einen Masterstudiengang im Fach Gebäude-, Energie- und Umwelttechnik an der HTWK Leipzig ab. Im Projekt BioSmoke beschäftigt er sich mit der Untersuchung und modellhaften Beschreibung natürlicher Verbrennungsprozesse von Wildfeuern hinsichtlich ihres Brandverhaltens, sowie der Entstehung und Verminderung von damit verbundenen Emissionen. Ziel ist ein CFD-Vorhersagemodell und Validierung durch Charakterisierung von Emissionen verschiedener repräsentativer Brennstoffmischungen.
Julia Olbrich ist seit Dezember 2024 am DBFZ als Gastwissenschaftlerin tätig. Im Projekt BioSmoke beschäftigt sie sich mit der Entstehung, Vermeidung und Verminderung von Luftschadstoffen aus natürlichen Verbrennungsprozessen. Der Fokus liegt dabei auf dem Einfluss der Zusammensetzung unterschiedlicher Biomassen.